Bei Vox auto mobil gibt es, neben Autotests, Service-Themen und Co. schon seit geraumer Zeit die Rubrik „Gefährlichste Strassen der Welt“. Das Rezept dieser Reportagen ist einfach: es geht um gefährliche Strassen. Ein unerschrockener Produzent verzichtet auf ordentliche Hotels, Linienflüge und Fahrvorstellungen an romantischen Orten und strebt stattdessen lieber die entlegeneren Ecken der Welt an. Bolivien, Afghanistan, Pakistan, sowas. Dort porträtiert er Strassen und Wege, die als besonders riskant gelten. Klingt einfach, ist es aber nicht. Es ist gefährlich.

Bisher kamen diese Beiträge immer ohne uns Moderatoren aus. Das ist seit Blochs Beteiligung im Film über einen in den Berg geschlagenen Tunnel in China anders. Seitdem will die Redaktion uns Moderatoren mit auf jene brenzligen Pfade schicken. Neulich wurde ich das erste Mal gefragt, ob ich nicht auch mal dabei sein will. Wie bitte? Wollten die mich los werden und durch Detlef Steves ersetzen?
Nein, nein, so die Chefs, der eigentliche Grund, mich mit auf die Strasse zu schicken sei ein anderer: wenn wir Moderatoren in den Filmen am Rande des Strassenzusammenbruchs auftauchen, so die Logik, hätten die Zuschauer in der anonymen Ferne eines unbekannten Landes ein bekanntes Gesicht an der Hand. Eins, das deutsch spricht. Das käme besser an.
Ah ja. Ich sagte zu. Ich mache ja fast alles für unsere Zuschauer. Fast.
Neulich stand nun also meine erste Mutprobe in dieser Disziplin an. Das Land, in dem ich diese Premiere genießen sollte heißt: Malawi.
Ja, genau das „Madonna-adoptiert-Kinder-in-Malawi“-Malawi. Das Malawi, das ohne diese Nachricht aus der Klatschpresse wohl die wenigsten hierzulande wahrgenommen hätten. Eines dieser ärmsten Länder der Welt irgendwo zwischen Südafrika und Somalia. Hier leben viele Menschen ohne Schuhe an den Füßen, ohne fließendes Wasser, ohne Strom und ohne Auto sowieso. Strassen gibt es dort natürlich trotzdem. Eine von ihnen ist besonders gefährlich: die sogenannte Gordon Road, die hunderte Meter bergab führt von einem Dorf namens Livingstonia bis an das Ufer des Malawisees.
Da sollten wir hin.

Das Briefing des Produzenten war umfangreich, ließ sich aber schnell mit einem Satz zusammenfassen.
„Denk an alle Impfungen, an 75 Dollar in bar für das Visum und: keine Sorge, die Gordon Road ist auf der Gefährlichste-Strasse-der-Welt-Skala eher Kategorie 2.“
Kategorie 2?
„Kategorie 2“, erklärte er mir, „steht für: man kann dort natürlich auch ums Leben kommen, und es ist sicherlich nicht ungefährlich. Aber machbar.“
Die Gordon Road ist unter den Gefährlichen Strassen also eher Grippevirus, nicht Ebola.
Strassen der deutlich lebensgefährlicheren Kategorie 1, Klopper wie Afghanistan und Pakistan, hatte er bis dahin ohne europäischen Kameramann absolviert. Zu gefährlich für Leib und Leben sei es dort zugegangen.
Jetzt, in Malawi, war also wieder Platz für den Kameramann, einem sympathischen Kerl aus Litauen. Und es war Platz für mich. Also packte ich außer guter Hoffnung noch Malaria-Prophylaxe, Mückenspray, stichfeste Kleidung und einen internationalen Führerschein in meine Reisetasche.
Der Flug führte uns durch die Nacht von Frankfurt erst nach Äthiopien. Nach einem vierstündigen Aufenthalt in Addis Abeba ging es weiter nach Lilongwe, der Hauptstadt Malawis.
Im Gepäck hatten wir außer Kameras, Mikrofonen und Stativen noch eine weitere Identifikation spendende Person für diesen außergewöhnlichen Beitrag: einen deutschen Professor namens Friedemann Schrenk

All-in-one Türöffner. Mitorganisator, Afrika-Kenner, Archäologe und Land Rover Defender Besitzer in einem. Während ich nach der Passkontrolle erstmal meine Malariatablette einwarf und prophylaktisch in einer Wolke aus Moskitospray verschwand, tat er das Gegenteil: statt den Tropenhut aufzusetzen, schlüpfte er in eine kurze Hose. Luftige Sandalen hatte er schon an. Sonnencreme? Was ist das. Da hab ich gemerkt: der ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Entweder ist er fahrlässig. Oder aber unerschrocken. So oder so wusste ich: der Mann kann Afrika. Und ich durfte ihn Fred nennen.
Am Flughafen in Lilongwe war fast alles angerichtet: der Zoll ließ uns auflagenfrei ins Land, die Sonne schien (knallhart) und Schrenks Defender stand abfahrbereit auf dem Parkplatz. Nur das Crewauto fehlte. Aus unerfindlichen Gründen konnte der eingeplante Fahrer des Professors nicht kommen, schickte dafür geschlagene zwei Stunden später einen Ersatzmann in einem Toyota Hilux vorbei. Das Auto: eher ungepflegt. Die Reifen: runtergefahren. Der Innenraum: verstaubt. Das Knarzen von der Hinterachse: unüberhörbar. Jeder deutsche TÜV-Prüfer hätte wohl die rote Karte gezeigt. In Malawi aber gelten andere Regeln, Hier sollte dieser Zustand als besserer Standard durchgehen, wie wir auf den kommenden Kilometern lernen würden.

Die Karawane war also abfahrbereit, um auf Malawis Strassen in die Nacht und in den Norden des Landes zu fahren. Diese Fahrt alleine war schon ein kleines Abenteuer. Die ersten Eindrücke dieses mir fremden Landes brannten sich wie ein Kinofilm auf meine eigentlich reisemüde Netzhaut. Ich war hellwach. Ich wollte aufsaugen, was ich da sah. Es war ebenso irritierend wie wunderschön. Die grüne Natur flog an uns vorbei und wurde immer wieder von roten Flecken unterbrochen, kleinen, erdigen Dörfern, die bei 100 km/h und Schrenks Ideallinie im Nu wieder hinter uns verschwanden. Der Geruch von glühendem Brennholz wehte durch die weit geöffneten Fenster des Defenders. Jedes Schlagloch schüttelte die Passagiere ordentlich durch. Weit und breit zeigte sich kein einziger Europäer. Zuhause schien Lichtjahre entfernt. Diese Welt war eine andere. Schrenk dagegen war in seinem Element. Während er den Defender lenkte, erzählte er locker und entspannt aus seinem Leben und brachte uns Wissenswertes zu Malawis Land und Leuten bei.
Wir fuhren auf einer der wenigen asphaltierten Strassen durch das selbsternannte Herz von Afrika. Ein archaisches, lebendiges Herz. Eines, mit sehr wenig Strom. Unser erster Halt in einer Art Supermarkt, wo wir für die insgesamt 462km und knapp sieben Stunden effektive Fahrtzeit etwas Proviant einkaufen wollten, führte mir das vor Augen: kein Licht, keine Käsetheke und ganz generell kein großes Warenangebot. Es gab zwar einen Stromanschluss. Aber keinen Strom.

Immerhin reichte es für Toastbrot, Erdnussbutter und Gin. Der Gin sollte später das Feierabendbier ersetzen, aber bis zum Feierabend war es noch ein weiter Weg. Als kleine Wegzehrung spendierte der Professor dem Team also einen seiner Lieblingssnacks: Grillfleisch auf Fahrradspeiche.
Schrenk fuhr die Strecke, nach über 20 Stunden Anreise wie ein Weltmeister. Fast mit verbundenen Augen fand er den Weg in den Norden. Es gab allerdings auf den ersten Paar hundert Kilometern nur die eine Strasse.
Gestoppt wurde nur noch zum Tanken. Bezahlt wurde bar, in Kwatcha, der Währung Malawis.
Größter Schein ist die 2.000 Kwatcha Banknote. Das entspricht in etwa zwei Euro. Einmal Defender volltanken bedeutet bei Benzinpreisen wie bei uns also, ein dickes Bündel Geldscheine parat zu haben. Schrenk bewahrte sie in einer Plastiktüte auf, die er wiederum in der Mittelkonsole des Defender aufbewahrte.

Mit der Zeit wurde es immer dunkler, und weder Fußgänger noch Radfahrer oder andere unbeleuchtete Objekte wie zum Beispiel Tiere (jede Menge davon) waren sonderlich gut sichtbar. Immer weiter ging es in die Nacht hinein und der asphaltierte Strassenbelag wechselte nach einem der wenigen Abbiegemanövern zu ruppigem Schotter. Im Defender war das bei unserem Tempo so gut auszuhalten, so wie eine Hot Stone Massage ohne heiße Steine, dafür mit Stößen bis ins Knochenmark. Trotzdem fielen mir immer wieder die Augen zu, denn die Dunkelheit hatte mittlerweile den Blick auf das Land verspeist. Schade, dachte ich nur noch, dass so ein Defender nicht auch als Schlafwagen taugt. Irgendwo fand ich beim Versuch, einzudösen immer eine Kante, an der sich Schädel, Schultern oder Schienbeine stießen.

Der Weg führte nur noch bergauf, immer weiter in die tiefe Nacht. Gegen Mitternacht waren wir angekommen in unserem Basislager für die nächsten Tage, dem Lukwe Eco-Camp. Erstmal strecken, Es knackte im ganzen Körper.
Jeder Neuankömmling bekam vom Wächter des Areals eine Lampe in die Hand gedrückt und einen Schlüssel für seine Hütte. Der Schlafmangel hatte sein Gutes – Spinnenweben auf Augenhöhe wurden einfach beiseite gewischt, raschelige Geräusche aus dem Busch ignoriert und exotische Krabbelviecher auf dem Boden übergangen. Es war zwar noch Zeit für ein gemeinsames feudales Dinner mit Erdnussbutter auf Toastbrot und lauwarmem Malawi Gin in lauwarmer Dosenlimo.

Dann aber fiel ich unter dem zweifelhaften Schutz eines löchrigen Mückennetzes in einen tiefen Schlaf. Auf der anderen Seite des Sees, in Tansania, donnerte ein Gewitter aufs Land, das mich mit seinen Lichtblitzen und seinen Donnerschlägen noch in meine Träume verfolgte. Badabumm.
Tags drauf, nach einem ordentlichen Frühstück mit unglaublichen Blick auf den Malawisee, nahmen wir die Gordon Road, eine der „Gefährlichsten Strassen der Welt“ in Augenschein und die Dreharbeiten nahmen ihren Lauf.

Zigmal ging es die Strasse in den kommenden Tagen hoch und runter. Das alles findet sich im Beitrag wieder. Es hatte nichts mit meiner gewöhnlichen Arbeit für Vox auto mobil zu tun. Nichts von dem Fahrbericht-Komfort in Europa oder von einem lockeren Ausflug in die Eifel. Auch die entspannte Atmosphäre der Classic Remise in Düsseldorf war weit, weit weg, genauso wie die Redaktion in Köln. Auch das dumme Gefühl, auf halbem Wege doch noch durch Detlef Steves ersetzt zu werden, sollte ich aus dieser Sache lebendig rauskam oder nicht: wie weggeblasen. Ich war angekommen.

Keine Automesse und keine schnelle Runde der Welt konnten in Sachen Erlebnisfaktor mit dieser über hundert Jahre alten Strecke mithalten, die die Malawis als notwendiges Übel tagein, tagaus in Kauf nehmen müssen, um den Berg hoch oder eben runter zu kommen. Ob zu Fuß (anstrengend) oder mit einem der unbequemen Gordon-Road „Taxis“ (teuer) – diese Strasse zu überwinden ist ein mühsames Unterfangen.
In unserem Land Rover Defender waren wir da fast schon fürstlich unterwegs.

Ja, es hatte einen kolonialen Beigeschmack, mit dem altbewährten britischen Bergebezwinger über Schotter und Steine zu pflügen. Aber ich wollte mit niemandem tauschen. Auch nicht mit den Kollegen, die in dem runtergerockten Hilux mal vor, mal hinter uns fuhren und sich die Sucher ihrer Kameras bei jedem Schlagloch ins Auge rammten.

Schrenk bekam beim Kontakt mit anderen Fahrern genug Offerten, seinen Land Rover zu verkaufen. Nicht, dass der in Malawi sonderlich erschwinglich gewesen wäre, aber beliebt ist er bei vielen. Zu oft fahren sich andere Fahrzeuge fest. Oder sie fallen auseinander, wenn der Defender gerade erst warm wird. Nicht umsonst wurde der Wagen von der Republik Malawi mit der Abbildung auf einem 50 Kwatcha Schein geadelt. Wir hatten also das richtige Fahrzeug dabei und begegneten auf der Strecke vielen neugierigen Augenpaaren und interessanten Menschen.

Während der Dreharbeiten erlebten wir aber auch Schattenseiten des Daseins in Malawi, denn unser Fahrer entpuppte sich als falsche Wahl für den Job. Er versuchte uns nach allen Regeln der Kunst an der Nase herumzuführen, erst mit falschen Angaben zum verabredeten Verdienst, dann mit offensichtlich heimlich abgezapften Diesel aus dem Hilux. Sein größter Coup kam aber erst noch: der Professor konnte zusammen mit einem lokalen Zivilpolizisten nachweisen, dass er dem Kamerateam eine Actioncam abgeluxt hatte. Sie wurde seit Tagen vermisst. Der Fahrer hatte stets anderen die Schuld über ihr Verschwinden zugeschrieben. Bis sie sich aber in seinem Gepäck wiederfand.
Das Ende vom Lied: wir standen ohne Fahrer da, nach vielen Lügen, mittelmäßigen schauspielerischen Einlagen seinerseits und – ungelogen – einer Verfolgungsfahrt über die Schotterstraßen Livingstonias, nach der er sich dazu entschieden hatte, die Flucht anzutreten. Der Pickup stand am Ende abgeschlossen vor seinem Gasthaus. Er selbst konnte sich offenbar ins Dickicht des Buschs retten.
Echte Polizisten kamen zu Hilfe, nein, anders: wir mussten sie abholen, aus dem Nachbardorf. Sie besaßen schlicht und ergreifend keinen Einsatzwagen. Dafür kamen sie mit Uniform, Weltkriegsgewehr und: Handgranaten!, um den beschlagnahmten Wagen zu konfiszieren.

Nach langem hin und her, und einer Nacht, in der uns klar wurde, dass wir das Fahrzeug noch für unsere Weiter- und die Rückfahrt zum Flughafen benötigten, konnten wir den Toyota wieder aus der Obhut der Ordnungshüter auslösen. Gegen einen nicht unerheblichen Unkostenbeitrag, versteht sich.
Vier Tage Dreharbeiten an der Gordon Road waren im Kasten, der Schock über die Flucht des Fahrers hatte sich gelegt, als wir schließlich für den Abschluss des Films weiter in den Norden nach Karonga fuhren. Dort steht ein Museum, für das Professor Schrenk ebenfalls tätig ist. Zwei Stunden später – nach getaner Arbeit und der letzten Aufnahme stand uns und unserem neuen Fahrer der gesamte lange Rückweg Richtung Flughafen bevor. 500 km auf malawischer Landstraße.
Sie zogen sich wie ein Kaugummi. Die Dämmerung brach herein und kurz vor Mitternacht stand noch ein Zwischenstopp zur Übernachtung in einem Ort namens Kasungu auf dem Plan. Kameramann, Produzent und ich ließen im Hotel bei einem letzten Shot Malawi Gin den gesamten, verrückten Trip noch einmal Revue passieren, bevor es ins Bett ging.
Tags drauf lagen zwischen uns und dem Abflug nach Hause nur noch 90 Kilometer von Kasungu bis zum Flughafen nach Lilongwe. Eine anderthalbstündige Fahrt zum Airport: dann wäre das Abenteuer beendet. Aber es war noch zu früh zum Entspannen, denn diese anderthalb Stunden hatten es in sich.
Unser neuer Fahrer, der mal eben so im Fahrzeug übernachtet hatte, war zwar pünktlich da. Aber dann meinte er erstmal zurecht: „wir müssen noch tanken, sonst bleiben wir irgendwo stecken.“
Na klar.
Also ging es zu einer Total Tankstelle. Hochmodern, wie es den Anschein hatte. Aber auch hier das selbe Spiel wie an vielen anderen Tankstops. Sie akzeptieren zwar Plastikkarten als Zahlungsmittel, aber keine europäischen. Kein Maestro und kein Kredit. Lediglich Kundenkarten. So eine hatten wir nicht. Da wir kaum mehr Bargeld hatten, lotste mich der Fahrer zum Geldautomaten der Bank of Malawi. Da standen bereits zwölf Malawis und wollten ebenfalls Geld abheben. Nach 20 Minuten warten unter der Sonne Afrikas brach, kurz bevor ich dran war, der Automat zusammen.
Out of service stand auf dem Bildschirm. What the fuck? stand auf meiner Stirn. Ich sah den Flug schon ohne uns abheben. Irgendwie bekamen wir aber doch noch 8.000 Kwatcha aus den Tiefen unserer Taschen zusammengekramt und konnten nach einer kurzen Betankung losfahren. Auf dem Weg klemmte der Gurt des Fahrers. Es war nicht das erste Mal. Ein halbe Stunde frickelte ich daran herum, öffnete die Verkleidung der B-Säule, versuchte mit dem Taschenmesser die Sperre zu lösen. Es half nix. Also trat ich irgendwann frustriert dagegen. Dann schnurrte er wieder und wir bahnten uns unseren Weg in den Süden.

Ausgerechnet jetzt, wo es scheinbar gut lief, spürte ich ein Rumoren im Magen-Darm Bereich. Genau das, was man braucht, wenn weit und breit kein zivilisiertes Klo auf einen wartet. Sanifair? Lichtjahre entfernt. Der Flughafen? Noch lange nicht erreicht. Ich kniff die Pobacken zusammen. War‘s das Omelette am Frühstück? War‘s das mutwillige Zähneputzen mit Leitungswasser? Der Fleischeintopf vom Vormittag? Es pressierte jedenfalls arg und ich freute mich über jeden gemachten Kilometer in Richtung Flughafentoillette.
Die schien in weiter Ferne als das nächste Hindernis vor uns auftauchte. Auf halber Strecke gerieten wir in eine Polizeikontrolle. Eigentlich hatten wir ja schon alles erlebt. Tiere auf der Fahrbahn, unregelmäßige Strassenblockaden, Kontrollposten der Einwanderungsbehörde, Menschen, die in völliger Dunkelheit durch die Wildnis wanderten. Alles erwartbar, nichts dabei, was die Weiterreise verzögert hätte. Aber dieser Stopp war anders. Der hielt uns länger auf. Denn es stellte sich heraus, dass der Toyota keine gültige Versicherung hatte. Da standen wir also. In einem Auto, dessen Besitzer wir nicht kannten, mit einem Fahrer, der mit der Sache ohnehin eigentlich nichts zu tun hatte, Zeitdruck im Nacken, um zum Flughafgen zu kommen, und einer fehlenden Versicherung. Mitten im Nirgendwo. Der Zeiger der Uhr lief unbeeindruckt weiter. Tick, tack. Der Fahrer versuchte alle Hebel in Bewegung zu setzen und telefonierte herum wie ein Bekloppter. Die Polizistin blieb auf meine Nachfrage hin stoisch: „Wenn Sie ein Problem haben, Ihren Flieger zu bekommen, klären Sie das mit dem Fahrer, der Ihnen dieses Problem eingebrockt hat. Er kann aber auch“, fügte sie mit eiskaltem Blick hinzu, „einfach 10.000 Kwatcha Strafe zahlen und weiterfahren.“
Das war die Rettung. Anstatt lange zu lamentieren bat ich ihn also, während mir der Schweiß in den verlängerten Rücken lief, die Strafe zu bezahlen, um endlich loszukommen. Er willigte leicht verärgert ein und handelte die Polizisten noch von 10.000 auf 5.000 K runter. Irgendwo hatte er die noch. Nach weiteren 10 Minuten, die ein zweiter Polizist benötigte, um eine Quittung auszustellen, rollte der Hilux endlich wieder.

Die letzten 20 km waren angebrochen. Ich hoffte, dass jetzt endlich alles glatt lief. Keine verdammte Ziege auf der Straße. Kein Platzregen. Und um Himmels Willen keinen geplatzten Reifen, der uns von der Strasse abkommen und uns einmal, zweimal, vielleicht dreimal überschlagen ließ. Ausgerechnet jetzt kam mir dieser Absatz von der Website des Auswärtigen Amts in den Sinn. Der, in dem drin steht, dass Verkehrsunfälle oft tödlich endeten.
Ein Schauer lief mir über den Rücken. Das Abenteuer war noch nicht überstanden.
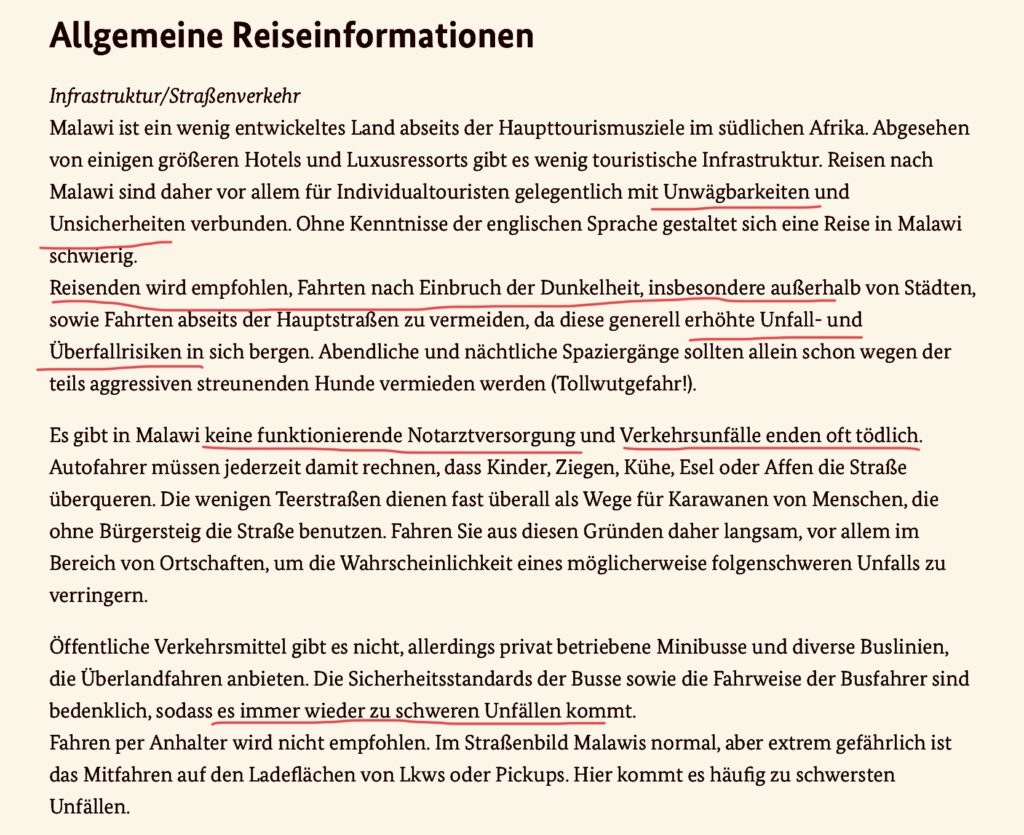
Das war sie also. Die andere gefährlichste Strasse Malawis.
Dieser Trip bekam aber ein Happy End. Nach einem letzten Aufbäumen gegen den Verkehr am Ortseingang der Hauptstadt, kamen wir endlich am Airport an. Für die entstandenen Unkosten drückte ich dem Fahrer meine letzten 10 Euro in die Hand. Und eine Tüte Haribo, die ich noch bei mir hatte. Dann: Einchecken. Erleichtern. Abheben.
Was nehme ich mit von diesem Ritt durch Malawi?
Es hat mir noch nie so gut getan, ein so andersartiges Land entdeckt zu haben. Gleichzeitig war ich noch nie so erleichtert, dieses andersartige Land auch heil wieder verlassen zu haben.
Ein Hoch also auf Malawi. Aber auch auf den Komfort unseres westlichen Lebens. Er ist alles, außer selbstverständlich.


